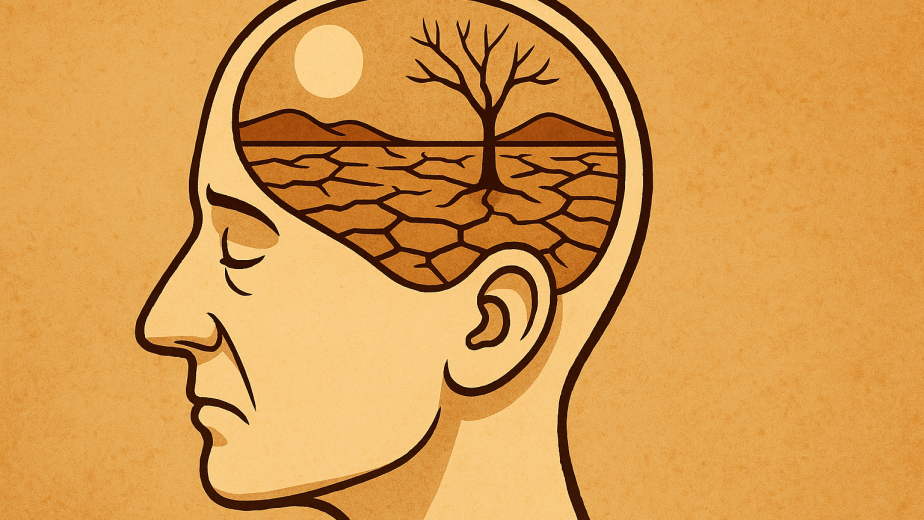Einleitung – aus Sicht von Free Speech Aid:
Bei Free Speech Aid setzen wir uns für Menschen ein, die aufgrund kritischer Äußerungen ins Fadenkreuz mächtiger Institutionen geraten. In diesem Fall berichten wir über Katharina Schmieder, freie Journalistin und Moderatorin – und ehemalige SWR-Redakteurin –, die durch ihre medienkritische Arbeit selbst zum Ziel eines öffentlich-rechtlichen Prangerformats wurde.
Auslöser war ein Tweet, in dem Schmieder darauf hinwies, dass ein aktiver Grünen-Politiker in einer Maischberger-Sendung gezielt im Publikum platziert war und während der Ausstrahlung abwertend gestikulierte. Der SWR reagierte darauf nicht mit Transparenz oder inhaltlicher Auseinandersetzung, sondern mit dem Film „Plötzlich Hassobjekt“, einer „Selfie-Reportage“, die Schmieder in unmittelbare Nähe zu Rechtsextremismus rückt, ihre Follower als „Keimkulturen“ illustriert und ihr vorwirft, persönliche Daten verbreitet zu haben – obwohl es sich um öffentlich zugängliche Informationen handelte.
Dieser Fall ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie schnell Kritik an mächtigen Medienakteuren in eine politische Stigmatisierung umschlagen kann. Wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender seine journalistischen Ressourcen dazu einsetzt, Kritiker persönlich zu diskreditieren, statt ihre Hinweise zu prüfen, berührt das den Kern der Meinungsfreiheit: die Möglichkeit, auch unbequeme Fragen zu stellen, ohne dafür von einem gebührenfinanzierten Milliardenapparat öffentlich gebrandmarkt zu werden.
Ein Erfahrungsbericht von Katharina Schmieder - Freie Journalistin und Moderatorin
Meinungsfreiheit ist das Fundament unserer Gesellschaft. Wer die Meinungsfreiheit abschafft, verhindert den Austausch von Ideen und freier Forschung, unterbindet kritische Stimmen und schlußendlich jede Innovation. Ohne Meinungsfreiheit können Schieflagen nicht benannt, die Obrigkeit nicht kontrolliert und individuelle Perspektiven nicht gehört werden. Wer die Meinungsfreiheit mittels Meldestellen, staatlicher Organe und steuerfinanzierter NGOs abschafft, sägt damit am Fundament der Demokratie. Der ÖRR sägt mit – an vorderster Front. Ein fundamentaler Missstand, dem dringend Einhalt geboten werden muss.
Kürzlich erschien das Stück „Plötzlich Hassobjekt“ im SWR. Eine Art Selfie-Reportage, die einmal mehr offenbart, dass der öffentliche Rundfunk nicht reformierbar ist. Er gehört abgeschafft.
Der Film „Plötzlich Hassobjekt“ ist ein Rachefeldzug gegen mich, weil ich in einem Tweet auf den Umstand hingewiesen habe, dass ein Grüner im Publikum in einer Maischberger-Sendung sitzt. Im Vorfeld machten mich Nutzer auf X darauf aufmerksam, dass während dieses Maischberger-Talks mit Wagenknecht und Weidel ein Mann im Publikum auffällige Grimassen zog und abfällig gestikulierte. Der Zuschauer hat damit seiner Verachtung gegenüber Weidel Ausdruck verliehen, was nicht zu übersehen war, da er direkt hinter der AfD-Vorsitzenden platziert war. Nachdem einige Nutzer auf Twitter entsprechende Clips gepostet hatten, stand die Vermutung im Raum, dass es sich hierbei um eine aktivistische Inszenierung handeln könnte. Wer das Sommerinterview mit Weidel gesehen hat, hat sicher eine Ahnung davon, dass Störaktionen jeder Art als ein „starkes Zeichen im Kampf gegen Rechts“ im ÖRR willkommen sind. Auch wenn diese das eigene Programm torpedieren.

Der Totalausfall des SWR
Im Stück „Plötzlich Hassobjekt“ macht der ÖRR nun gemeinsame Sache mit dem Grünen, der sich durch unflätige Kommentare nach seiner Teilnahme bei Maischberger in seiner Lebensqualität beeinträchtigt sieht. Der Film beleuchtet nicht nur das Leiden des jungen Grünen, sondern möchte auch Mitleid für eine Influencerin erzeugen, die öffentlich Phantasien äußert, die Bewohner Sachsens mit Napalm auszulöschen. Wer jetzt meint, dass dies eine Absonderung darstellt, die man tatsächlich als hasserfüllt bezeichnen könnte, der liegt falsch. Denn das sei ein Witz, so die Erzählung im Film. Dass abfällige Kommentare ein lagerübergreifendes Phänomen sind, scheint der Autorin fremd zu sein.
Im Film untersuchen „Datenjournalisten“ meinen X-Account und stellen fest, dass mir ein Landtagsabgeordneter der AfD folgt. Warum die „Datenjournalisten“ nicht rausgefunden haben, dass ich diesem Nutzer nicht folge, bleibt schleierhaft.

Ein weiterer Befund wird in einer animierten Grafik illustriert: Unter meinen Followern gibt es Nutzer, die blaue Herzen oder eine Deutschlandfahne im Profil haben.
Eine weitere Grafik scheint inspiriert von Petrischalen, in denen Keime schwirren. Die kleinere Schale schiebt sich über die größere, eine Schnittmenge entsteht. Die Namen meines Accounts und der des Youtubers Tim Kellner werden eingeblendet. Dieses Bild zeigt den Zuschauern auf, dass die Keime in der kleinen Schale meine Zuschauer darstellen und die in der größeren, die des Youtubers Tim Kellner. Das ist nun gebührenpflichtiger Qualitätsjournalismus, wenn SWR-„Datenjournalisten“ herausfinden, dass es Nutzer gibt, die sowohl mir als auch Tim Kellner folgen.

Die Erkenntnis, dass es Accounts gibt, die wiederum anderen folgen, scheint dem SWR eine so bahnbrechende Botschaft im Sommer 2025 zu sein, dass diese unbedingt im Film untergebracht werden muss. Das Stück ist voller Text/Bild-Scheren. Beispielsweise behauptet die Sprecherin, ich würde „persönliche“ Daten über den Grünen verbreiten. Im Bild sieht man, dass ich öffentlich zugängliche Quellen nutze, wie Webseiten oder den Instagram-Account der Grünen Jugend Osnabrück. Ich halte das für eine arglistige Täuschung des Publikums. In einer ersten Fassung stimmten die Zahlen zu meinem Account nicht. Klammheimlich wurde eine korrigierte Version in die Mediathek geladen, jedoch ohne redaktionellen Hinweis, dass zunächst Falschinformationen gezeigt wurden. Das Stück „Plötzlich Hassobjekt“ strotzt vor Fehlern und Mängeln , dass man ernsthaft die Frage stellen muss, wer das für sendefähig erklärt hat.
Erodierende Glaubwürdigkeit der Anstalten
Auf X habe ich etwa binnen drei Jahren rund 700 Fälle dokumentiert, bei denen Politiker ohne Kennzeichnung in einem politischen Kontext im Programm des ÖRR auftauchen. Es geht dabei um Publikumsmeldungen in Talkshows, befragte Passanten bei Straßeninterviews oder um Experten-Statements. Ich halte das für hochproblematisch, da so den Zuschauern wichtige Informationen vorenthalten werden, um das Gesagte richtig einzuordnen. Diese fehlende Transparenz betrifft auch eigene Mitarbeiter, die beispielsweise in der Rolle eines Passanten oder Aktivisten im Programm auftauchen. Auch Mitglieder der eigenen Kontrollgremien, die Rundfunkräte, werden als als Demo-Teilnehmer oder Experten interviewt, ohne dass dem Zuschauer mitgeteilt wird, welches Amt diese Protagonisten in einer Anstalt bekleiden.
Meine Mitstreiter und ich dokumentierten im Januar 2024 rund 100 Politiker verschiedener Parteien, die ohne Kennzeichnung als Bürger getarnt, auf den „Demos gegen Rechts“ interviewt wurden. Dass diese Interviewpartner überwiegend Grüne, Sozialdemokraten und Anhänger von „Die Linke“ sind, die gegen die Opposition auf die Straße gingen, teilte der ÖRR seinen Zuschauern nicht mit.
Bei meinen Betrachtungen treibt mich die Frage um, inwiefern es sich dabei um schlampiges Handwerk oder um eine absichtliche Täuschung der Zuschauer handelt.
Hetze gegen Kritiker
Der schlichte Hinweis, dass ein Grüner im Maischberger-Publikum sitzt, legitimiert den SWR nun dazu, mich als „rechtsextrem“ zu brandmarken. Und zwar auf mehreren Ebenen. Neben der Selfie-Reportage sind weitere Promotion-Beiträge, unter anderem auf tagesschau.de erschienen.
Ich äußere mich betont sachlich über den ÖRR. Mit meiner Arbeit reiche ich die Informationen an meine Leser, die nötig sind, um die politischen Statements im ÖRR-Programm richtig einzuordnen. Anstatt sich mit meinen Hinweisen konstruktiv auseinanderzusetzen oder diese respektvoll zu ignorieren, entscheidet sich der 9 Milliarden-Apparat dafür, mich als „Rechtsextreme“ zu degradieren.
Der Umgang mit ehemaligen Mitarbeitern
Ich habe einige Jahre beim SWR als Redakteurin gearbeitet. Umso erstaunter war ich, als mich die Autorin des Stücks auf meiner privaten Email kontaktierte. Es liegt nahe, einen datenschutzrechtlichen Verstoß gegen den SWR auszumachen. Zu dieser Zeit erreichte den SWR eine Presseanfrage, um den Sachverhalt über den Umgang mit meinen Daten zu klären. Der SWR sah sich nicht genötigt, das Problem zu unterbinden. Weitere Antworten dieser SWR-Pressestelle liegen mir vor, bei denen die anfragenden Journalisten getäuscht werden. Den Umstand, dass mich die Autorin auf meiner privaten Email kontaktiert hat, betont diese im Film. Was der Mehrwert dabei für den Zuschauer darstellen soll, bleibt offen. Bisher hat sich der SWR nicht geäußert, wie die Autorin an meine Daten gelangt ist.
Der ÖRR ist nicht reformierbar
Das Stück „plötzlich Hassobjekt“ markiert einen neuen Tiefpunkt der Anstalten. Hier wird deutlich, dass dem ÖRR jeglicher Anstand gegenüber seinen Kritikern entronnen ist. Ich werde mich dagegen zur Wehr setzen. Meine Untersuchungen hinsichtlich des Programms werde ich fortführen und ausbauen.
(Katharina Schmieder ist Freie Journalistin und Moderatorin)