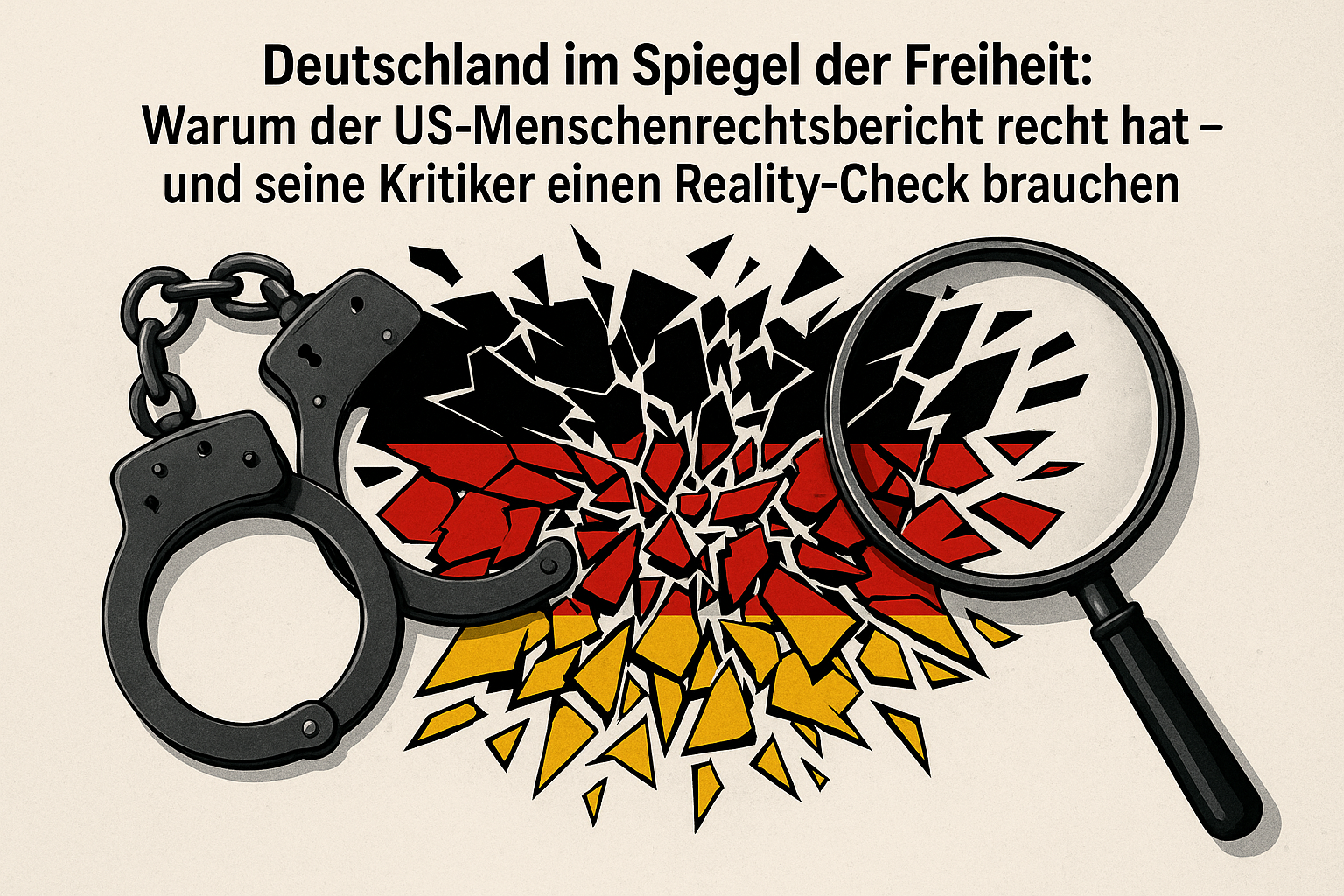Der Befund, den niemand hören will
Am 12. August 2025 veröffentlichte das US-Außenministerium seinen jährlichen Bericht zur Menschenrechtslage 2024. In der deutschen Sektion steht der Satz, der Berlin in Aufruhr versetzte: Einschränkungen der Meinungsfreiheit
, flankiert von Hinweisen auf Zensur
auf digitalen Plattformen und eine problematische Behördenpraxis. Wer das als bloß „politisch motiviert“ abtut, überspielt die Sachebene. Dass der Bericht unter Präsident Trump und Außenminister Rubio erscheint, ist politischer Kontext – keine Widerlegung der Diagnose.
Das deutsche Zensur-Paradox: privatisierte Eingriffe unter staatlichem Druck
Der Kernpunkt, den die USA benennen, ist kein Missverständnis, sondern eine Strukturfrage: Deutschland zwingt Plattformen mit Löschfristen und Bußgeldern zu raschem Eingriff in Kommunikationsprozesse. Das ist keine „Community-Regel“, sondern staatlich induzierte Inhaltsregulierung. Bereits 2018 warnte Human Rights Watch vor dem „gefährlichen Präzedenzfall“ des NetzDG: Die Kombination aus kurzen Fristen, Sanktionsdrohung und unklaren Rechtsbegriffen produziert Overblocking – den vorauseilenden Gehorsam der Moderation.
Der US-Bericht setzt genau hier an, wenn er von government censorship
in den digitalen Räumen spricht. Dass dies in Deutschland als „Schutz vor Hassrede“ etikettiert wird, ändert am Wirkmechanismus wenig: Wo Strafandrohung Plattformlogiken regiert, schrumpft der Debattenraum an den Rändern zuerst – dort, wo Dissens, Polemik, ja auch Irrtum und Zumutung leben. Die FAZ-Zusammenfassung benennt diese Stoßrichtung klar; der deutsche Reflex lautet dagegen: „Es findet hier keine Zensur statt.“
„Es findet keine Zensur statt“ – die beruhigende Tautologie
Der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer versicherte in der Regierungspressekonferenz vom 13. August 2025 Deutschland ist eine gefestigte Demokratie … Es findet hier keine Zensur statt.
Das klingt wie eine Selbstvergewisserung, ist aber analytisch leer: Eine Demokratie kann Zensur nicht dadurch wegdefinieren, dass sie Zensur nur als Vorzensur durch eine staatliche Behörde versteht. In digitalen Öffentlichkeiten wirkt Zensur systemisch: durch Fristen, Bußgelder, Blocking-Anreize, Meldeportale, Algorithmik und aufschaukelnde Compliance-Ketten.
Dass große Teile der deutschen Öffentlichkeit dieses Systemische nicht sehen (wollen), belegt eher den Befund als sein Gegenteil. Und es erklärt, warum die USA – aus ihrer First-Amendment-Tradition heraus – sensibler auf diese Verschiebungen reagieren als eine hiesige Debattenkultur, die Ordnung über Offenheit priorisiert.
Strafrecht als Diskurspolitik: §130, §188, Hausdurchsuchungen
Niemand bestreitet, dass Volksverhetzung (§ 130 StGB) und Holocaustleugnung strafbar sind. Die Frage lautet: Wie weit dehnt der Staat die Grenzziehung aus – und mit welchen Mitteln? Die Verschärfung von § 188 StGB (Schutz „politischer Personen“ vor Beleidigung) signalisierte eine Priorisierung des Ehrschutzes Amtsträger gegenüber der Robustheit öffentlicher Kritik. Der US-Bericht listet Fälle von Hausdurchsuchungen und Verurteilungen wegen Online-Äußerungen als Indikatoren einer übergriffigen Staatsmoral – eine Lesart, die selbst von hiesigen Staatsrechtlern in Teilen geteilt wird (vgl. Zusammenfassungen bei WELT).
Der vielbeschworene „politische Kontext“ – und warum er das Argument nicht rettet
Ja, der Report ist in Teilen neu justiert; internationale Analysen vermerken eine Verschiebung der Schwerpunkte seit Amtsantritt Trumps (vgl. Financial Times). Ja, Reuters zeigte exklusiv, dass Außenminister Rubio US-Diplomaten anwies, in Europa gegen den DSA zu lobbyieren (Reuters-Bericht). Aber Doppelmoral widerlegt keinen Missstand. Selbst wenn der Überbringer heuchelt, bleibt die Frage: Stimmt der Befund?
Gerade die US-Fokussierung auf die Architektur der europäischen Inhaltsregulierung (NetzDG, DSA) trifft einen wunden Punkt. Deutschland hat die Privatisierung des Eingriffs perfektioniert – die Verantwortung wird in AGBs und Moderationsleitfäden ausgelagert, die Antriebsenergie liefern Gesetz und Behörde. Wer das nicht Zensur nennen will, muss zumindest einräumen: Es ist die Systematisierung eines Chilling Effects.
Die Rhetorik der Beruhigung – ein deutsches Spezialgebiet
„Alles im Rahmen des Rechtsstaats“, „wehrhafte Demokratie“, „keine Zensur“ – die Lieblingsformeln eines Landes, das aus der Geschichte gelernt haben will, ohne ihre Lehre auf digitale Räume zu übertragen. Die mediale Abwehr folgt zuverlässig: „In Berlin quittiert man den Befund“ (SPIEGEL) – quittieren heißt hier: verneinen. Die Frage, wie viel freie Rede der Rechtsstaat aushält, wird in eine Frage der Gesinnung umcodiert.
Was folgt daraus? Drei unbequeme Hausaufgaben
- Begriffe entgiften: „Hassrede“ ist kein Rechtsbegriff, sondern eine Gummiformel. Wo sie zur Ankerklausel für Eingriffe wird, entsteht ein Freibrief zur elastischen Erweiterung. Die rechtliche Schwelle muss klar justiziabel sein – sonst entscheidet die Empörung, nicht das Gesetz
- Transparenzpflichten verlängern: Wenn der Staat moderieren lässt, muss er Rechenschaftspflichten auferlegen: öffentliche Kennzahlen zu Meldungen, Löschungen, Sperren; Beschwerde- und Revisionswege; Hard Cases müssen überprüfbar sein. Sonst regiert die Blackbox.
- Strafrecht zurück auf seinen Platz: §130 und §188 müssen eng ausgelegt werden. Hausdurchsuchungen wegen Posts sind ultima ratio, nicht Polizeiroutine. Wer den Strafrahmen erweitert, darf sich über die politische Kühlung des Diskurses nicht wundern
Der unbequeme Spiegel
Der US-Menschenrechtsbericht mag politisch gefärbt sein – er ist dennoch ein Spiegel. Was er zeigt, ist kein finsterer Autoritarismus, sondern etwas Heimtückischeres: die langsame, rechtlich abgesicherte Verengung der Rede durch Fristen, Pflichten, Meldeketten, Strafnormen.
Berlin kann das wegformeln; die Realität bleibt. Wer ihn reflexhaft als „Propaganda“ abtut, verwechselt Moral mit Analyse. Freiheit ist nicht das, was in der Regierungspressekonferenz beschworen wird – sie ist das, was übrig bleibt, wenn man ihre Gegner nicht kriminalisiert.