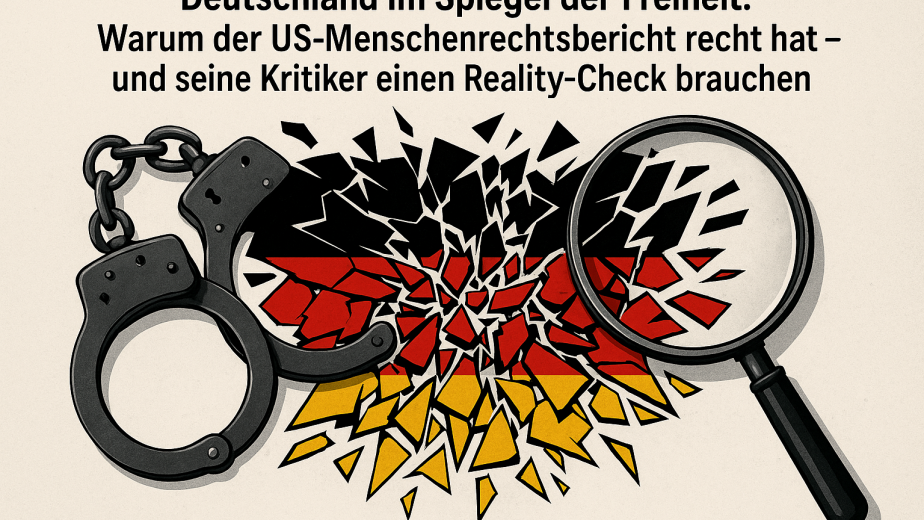Ein Beitrag von Joana Cotar
Wenn Parlamente sich anmaßen, nicht nur den Raum politischer Debatte zu ordnen, sondern die Grenzen des Sagbaren selbst zu verschieben, dann rückt die Demokratie gefährlich nah an ihr eigenes Gegenteil. Genau diese Entwicklung beschreibt der jüngste Bericht des US-amerikanischen Judiciary Committee zum europäischen Digital Services Act (DSA). Er liest sich nicht wie ein nüchternes Gesetzesgutachten, sondern wie eine Warnschrift. Die EU schaffe ein Zensurinstrument, das über ihre Grenzen hinaus wirkt bis hinein in die Vereinigten Staaten, wo die Verfassung die Meinungsfreiheit als heiliges Gut schützt.

Transatlantisches Problem oder europäische Realität?
Was im Bericht als transatlantisches Problem benannt wird, ist in Wahrheit längst europäische Realität. In Deutschland kennt jeder, der in sozialen Netzwerken offen spricht, das Klima der Einschüchterung: §188 StGB („Beleidigung von Politikern“), Hausdurchsuchungen wegen missliebiger Tweets, Meldestellen und Prozesse, die Bürger in Angst versetzen sollen.
Schwammige Begriffe wie „Hass und Hetze“ werden jeweils passend ausgelegt, interpretiert und genutzt, um „unsere“ Demokratie zu schützen. Dabei zerstört ein solches System das Fundament der Demokratie selbst – die Freiheit des Wortes.
Der DSA – Sicherheit als Vorwand, Zensur als Praxis
Der Bericht des US-Repräsentantenhauses arbeitet akribisch heraus, wie der DSA funktioniert. Plattformen wie X, Facebook oder TikTok müssen systemische Risiken analysieren und mindern; nicht nur bei illegalen Inhalten, sondern auch bei solchen, die von Brüssel als „gesellschaftlich schädlich“ bewertet werden.
Wer sich verweigert, riskiert Strafzahlungen von bis zu 6 Prozent des weltweiten Umsatzes – ein ökonomisches Damoklesschwert, das dafür sorgt, dass Unternehmen sich lieber in vorauseilendem Gehorsam selbst zensieren.
Damit wird aus einem angeblich technischen Regulierungsrahmen ein politisches Werkzeug. Der Bericht dokumentiert Fälle, in denen EU-Behörden oder Mitgliedstaaten Plattformen aufforderten, Beiträge zu löschen, die weder Gewalt enthielten noch gegen US-Recht verstießen. Kritik an Einwanderungspolitik, Skepsis gegenüber Elektroautos, provokante politische Slogans – alles wird unter Verdacht gestellt.
Beispiele der Eingriffe – von Paris bis Warschau
Die Fallbeispiele, die das Komitee zusammenträgt, sprechen eine klare Sprache:
Frankreich forderte die Entfernung eines US-Posts, der die französische Einwanderungspolitik kritisierte.
Polen drängte TikTok, ein Video aus den USA zu löschen, das sich über Elektroautos lustig machte.
Deutschland sah in einem Tweet, der die Abschiebung einer syrischen Familie forderte, „Hassrede“ und verlangte Entfernung.
Das sind keine Bagatellen. Es sind Belege für ein System, das versucht, nationale Meinungsgrenzen global durchzusetzen.
Stimmen der Warner – Musk und Durov
Es ist bezeichnend, dass zwei Männer, die selbst Plattformen kontrollieren, öffentlich Alarm schlagen: Elon Musk und Pavel Durov.
Musk sprach mehrfach davon, dass die EU versuche, eine „Zensur-Bürokratie“ zu etablieren, die keine Grenzen kenne. Seine Aussage, dass man „Demokratie nicht exportieren, aber sehr wohl Zensur importieren“ könne, bringt es auf den Punkt. Er warnte, dass Plattformen aus Angst vor EU-Strafen beginnen würden, Inhalte weltweit zu löschen und damit europäische Maßstäbe zur globalen Norm würden.
Pavel Durov, Gründer von Telegram, ging noch weiter: Er beschrieb die Versuche deutscher Behörden, Telegram unter Druck zu setzen, als eine Form von „staatlicher Repression“. Er betonte, dass autoritäre Züge längst nicht mehr nur in Russland oder China zu beobachten seien, sondern mitten in Europa, wo Regierungen in der Sprache der Demokratie auftreten, während sie deren Substanz aushöhlen. Für seine offenen Worte und seine Weigerung, Beiträge und Gruppen zu löschen, wurde er in Frankreich verhaftet und darf das Land immer noch nicht verlassen.
Dies ist der Kontext, in dem der DSA wirkt: nicht als neutrales Regelwerk, sondern als Multiplikator einer repressiven Tendenz.
Forderungen des Judiciary Committee
Das Judiciary Committee bleibt nicht bei der Analyse stehen. Es stellt klare Forderungen:
Klares Nein zu exterritorialer Wirkung – Amerikaner dürfen nicht durch EU-Gesetze eingeschränkt werden.
Diplomatischer Druck – Die US-Regierung soll Brüssel und Berlin deutlich machen, dass Redefreiheit nicht verhandelbar ist.
Transparenz – Plattformen müssen dem Kongress melden, welche Zensuraufforderungen sie erhalten.
Alternatives Modell – Die USA sollen ein „freies Internet“ hochhalten, ohne präventive Inhaltskontrolle.
Die Botschaft ist klar: Amerika will nicht zulassen, dass Europa zur globalen Zensurbehörde wird.
Der Kampf um die öffentliche Meinung
Doch auf genau diesem Weg befinden wir uns längst, denn die politische Klasse – in Berlin und in Brüssel – hat erkannt, dass sie den Einfluss über die öffentliche Meinung in klassischen Medien verliert. Die Bürger diskutieren in Netzwerken: unabhängig, plural, oft unbequem. Diese Machtverschiebung soll rückgängig gemacht werden.
Der DSA ist nichts anderes als der Versuch, das digitale Forum wieder unter politische Kontrolle zu bringen.
Eine Demokratie lebt jedoch nicht von Konsens, sondern vom Streit. Sie braucht das Unbequeme, das Schrille, das Unangepasste. Wer abweichende Stimmen kriminalisiert oder pathologisiert, zerstört nicht „Hass“, sondern Demokratie.
Dass Politiker sich durch §188 StGB besonderen Schutz verschaffen, zeigt die Verkommenheit dieses Systems. Ausgerechnet diejenigen, die Macht ausüben, immunisieren sich gegen Kritik.
Die historische Dimension
Für die USA ist das nicht nur eine Frage nationaler Souveränität, sondern eine historische. Die First Amendment-Tradition macht keinen Unterschied zwischen populären und unpopulären Meinungen. Wenn amerikanische Plattformen beginnen, europäische Maßstäbe weltweit durchzusetzen, dann wird diese Tradition ausgehöhlt.
Und das – so macht der Bericht deutlich – werden die USA nicht zulassen.
Freiheit braucht Mut
Der Bericht des Judiciary Committee ist mehr als eine juristische Analyse. Er ist ein politischer Aufruf. Er fordert Widerstand gegen eine Entwicklung, die in Europa längst Alltag ist.
Elon Musk und Pavel Durov haben recht, wenn sie sagen, dass die Unterdrückung der Menschen heute nicht mit Panzern kommt, sondern mit Formularen, Bußgeldern und Gesetzen, die im Namen des Guten das Grundlegendste zerstören: die Freiheit.
Es liegt an uns, ob wir uns einschüchtern lassen – oder ob wir den Mut haben, der Demokratie das zurückzugeben, was sie im Kern ausmacht: das Recht, frei zu sprechen, auch wenn es unbequem ist.